
23.11.2007 / 15:04 / Jan Bölsche liest: Mecki im Schlaraffenland (Eduard Rhein)
Bite my shiny meaty ass! (5-6)

Irgendetwas an diesen Tieren irritiert fundamental (Foto: regular) Die Szene verstört: Untote Schweine mit Brandverletzungen dritten Grades und Messern im Rücken. Gerupfte und dennoch offenbar noch flugfähige Zug- und Singvögel mit ebenso versengter Haut. Ein bescheuerter Pilzhut auf einem geifernden grünen Wicht, der mit einer Fliegenklatsche auf sieben echt syrische Goldhamster eindrischt wie eine übereifrige 50er-Jahre-Hausfrau auf einen staubigen Teppich. Das soll es sein, das gelobte Land?
Ein Arbeitsaufenthalt bei Oma ist das geeignete Mittel, um das Konzept "Schlaraffenland" wirklich zu durchdringen. Es gibt Rindsroulade, Rote Grütze mit Vanillesosse, Torte, Himbeergeist, Sekt, Bier, Gurken zum Abendbrot und auch sonst alles! Ich versuche, mir den Appetit durch das Schreckensbild im Kinderbuch nicht verderben zu lassen.
Jemand hat offenbar auch an dieser Zonengrenze eine Alarmanlage installiert, denn der König weiss Bescheid und lauert samt Leibgarde hinter der Hirsebreisauerei auf die Einreisewilligen.
Mecki ist angekommen. Und das Erste, was ihm auffällt, sind die Jungfrauen, die König Plum zu dekorativen Zwecken mitgebracht hat und die zusammen mit den geschändeten Zombietieren jetzt in eine fast schon hawaiianische Begrüssungseuphorie einstimmen. König Plum legt wie die meisten Despoten Wert darauf, durch total demokratische Wahlen zu seinem Amt gekommen zu sein. Es wird betont, das Volk liebe ihn, weil er am meisten essen kann und am längsten von allen schläft. Das ist ähnlich glaubhaft wie der Hinweis darauf, dass die Tiere keine Schmerzen empfinden, wenn man sich eine Scheibe von ihrem Hintern abschneidet oder einen Flügel abreisst. Sicher soll auch die Honigkuchenmauer nicht etwa einen Exodus verhindern, sondern gefährliche Faschisten auf Abstand halten.
Schon nach wenigen Sekunden endet die Begrüssung, denn der König ist eingeschlafen. Man kennt diese Symptomatik von Meetings mit Kathrin Passig: Der König gründet seine Herrschaft auf Narkolepsie. Im Gegensatz zu Passigs wackeligen Thron ruht Plums Macht – so möchte ich unterstellen – aber stabil auf noch einer zweiten Säule: Bulimie.
Ungeduldigen Lesern, die sich weniger als 14 Tage mit dieser Doppelseite beschäftigen, weil sie ihr Werk schneller, aber somit eben auch weniger gewissenhaft verrichten als die Plattentektonik das ihre, entgeht sicher ein gezeichnetes Detail im körnigen Hirsebrei: Ein Pinguinschnabel guckt da bereits heraus.
Meckis grosser Angstgegner, Charly Pinguin, wird nun jeden Moment in Erscheinung treten, wie Moby Dick, der bereits Wasser aus seinem Atemloch bläst.
Was haben eigentlich immer alle gegen Pinguine? Wallace & Gromit, Batman, Microsoft Monthly – sie alle stossen in das selbe Horn: Diese Vögel seien böse, niederträchtig und unzuverlässig. Die Begründungen sind oft vage bis offensichtlich unzutreffend und reichen von chronischem Overdressing über Raffgier und Gefühlskälte bis hin zu mangelhafter Benutzerfreundlichkeit. Mecki und Eduard Rhein lassen uns einfach ganz im Unklaren darüber, warum es denn nun wünschenswert sei, dass Charly Pinguin Trübsal bläst, weinend zu Hause sitzt und auf jeden Fall aber mal ganz weit weg ist. Ich habe das hier aus Gründen des Mitgefühls bislang unterschlagen: Charly Pinguin wurde bislang auf jeder einzelnen Textseite ohne jede Begründung gedisst. Und zwar auch von den sieben echt niedlichen Goldhamstern.
Oma bringt gestiftete Birnen und Äpfelachtel: "Fernsehen fängt gleich an. Nimm nur reichlich, wir haben draussen noch!"
23.11.2007 / 13:17 / André Fromme liest: Esra (Maxim Biller)
Hilferufe aus dem Metaraum (9-28)

Kakteen bei Nacht. Foto: selbst verwackeltHerrje, das hatte ich mir spassiger vorgestellt. Naja, jedenfalls weniger anstrengend.
Doch der Reihe nach.
Bekannt ist, dass dem Ich-Erzähler im Laufe des Buches eine Beziehung in die Brüche geht. So weit, so unspektakulär. Bekannt ist auch, dass Ich-Erzähler und Autor in diesem Fall weitestgehend deckungsgleich sind und dass auch die restlichen Hauptpersonen de facto deckungsgleiche Entsprechungen im echten Leben haben.
Die Neugierstimulanz auf meiner Seite: Kommt man als Leser darüber hinweg, dass man das weiss? Man kommt beim Lesen ja einerseits über so vieles hinweg. Von allüberall schallen einem aus den Zeitungen und dem Freundeskreis irgendwelche Meinungen entgegen – und doch hindert einen eine positive Rezension meist nicht daran, ein Buch trotzdem eher egal oder blöd zu finden (bzw. umgekehrt). Andererseits – es gibt auch Wissen, das man nicht plötzlich zu Unwissen machen kann. Klassisches Beispiel Christkind (bzw. Weihnachtsmann, je nach Region und Familientradition): wurde einem einmal eröffnet, dass es das in Wirklichkeit gar nicht gibt – jedenfalls nicht als geschenkebringendes Wesen, ich werde mich hüten, hier eine religiöse Debatte loszutreten – gibt es kein Zurück mehr und auch Nikolaus und Osterhase beleuchtet man danach etwas kritischer.
Bei »Esra« ist es ähnlich, aber mit umgekehrten Vorzeichen: Während man beim Christkind entdecken musste, dass etwas vermeintlich Echtes nur fiktiv ist, so ahnt man bei Esra, dass das vermeintlich Fiktive echt ist.
Beispiel? Gern. Erster Satz des Buchs: »[Damals] schien es so als würden Esra und ich es vielleicht doch noch schaffen.« Dieser Satz ist nicht deshalb gekürzt, weil ich zu faul bin, ein paar Worte mehr zu tippen, sondern, weil er direkt mit einer Passage beginnt, die Esras Mutter recht genau beschreibt. Das setzt sich in den nächsten Sätzen so fort (um eine Identifizierung mittels Google ja nicht zu schwer zu machen), garniert mit zahlreichen direkten und indirekten Hinweisen darauf, was der Ich-Erzähler von ihr hält. Richtig: nicht so furchtbar viel.
So geht es dann munter weiter. Man kommt gar nicht dazu, sich wirklich mit der Handlung zu beschäftigen, weil man die ganze Zeit mit mindestens der ersten Metaebene zugange ist (»Soso, deshalb fühlten die echte Esra und ihre Mutter sich etwas zu erkennbar beschrieben.«). Ziemlich schnell spannt sich eine weitere Metaebene vor einem auf: Esra verbietet dem Ich-Erzähler, über sie zu schreiben. Was diesen wiederum zu Reflexionen darüber anregt, dass man ihm ja mit dem Schreiben über bestimmte Dinge auch direkt das Atmen verbieten könne. Eine halbzerknitterte zusätzliche Metaebene flicht Biller ausserdem noch ein, denn durch all das Philosophieren über Schreibverbot und Atemnot landet er schon auf Seite 17 an einem Punkt, an dem er es für eine gute Idee hält, sich quasijuristischen Beistand bei Thomas Mann zu holen. Der habe sich schliesslich mit seinem ersten Roman gegen den Widerstand aus der Lübecker Elite (die sich damals ein bisschen zu genau getroffen fühlte) durchgesetzt und somit ebenfalls für die »Freiheit der Literatur« gekämpft, wie Biller ganz unbescheiden schreibt. Dumeinegüte.
Da hat man ja nicht den Ansatz einer Chance, mal kurz zu vergessen, dass im Fiktiven das Echte steckt. Man bekommt's – einschliesslich Verteidigungsargumentation – permanent auf die, in meinem Fall erkältete und vielleicht auch deshalb etwas empfindliche, Nase gebunden.
Ich habe im Moment ein bisschen Angst vor den nächsten Seiten.
Bei der Lektüre gehört und für empfehlenswert befunden:
• Chow Chow – Colours & Lines (2007)
• Soul Coughing – El Oso (1998)
Bei der Lektüre gehört und für nur mässig interessant befunden:
Dieses Jahr hat's beim Domino Day nicht geklappt, den Domino Day-eigenen Dominostein-Umfall-Weltrekord zu brechen.
André Fromme / Dauerhafter Link / Buch kaufen und selber lesen
23.11.2007 / 10:29 / Volker Jahr liest: Reise um die Welt (Georg Forster)
In 1111 Tagen um die Welt (0-0)
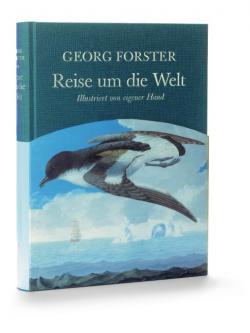 Vor wenigen Wochen hat hier in Kassel eine riesige Thalia-Buchhandlung aufgemacht. Bettina, meine Buchhändlerinnenfreundin aus Berlin (an dieser Stelle jetzt eine flashanimierte Werbeeinblendung für den Kollektivbuchladen Anagramm am Mehringdamm hindenken) sagt, dass Thalia das Böse sei, zwar seien auch andere wie Hugendubel oder Habel das Böse, aber Thalia noch mehr, weil es den Verlagsvertretern als grösster der Grossabnehmer die miesesten Bedingungen diktieren könne.
Vor wenigen Wochen hat hier in Kassel eine riesige Thalia-Buchhandlung aufgemacht. Bettina, meine Buchhändlerinnenfreundin aus Berlin (an dieser Stelle jetzt eine flashanimierte Werbeeinblendung für den Kollektivbuchladen Anagramm am Mehringdamm hindenken) sagt, dass Thalia das Böse sei, zwar seien auch andere wie Hugendubel oder Habel das Böse, aber Thalia noch mehr, weil es den Verlagsvertretern als grösster der Grossabnehmer die miesesten Bedingungen diktieren könne.
Ich kann das nicht direkt bestätigen, hatte aber, vermittelt über meine Tochter, auch schon unter Thalia zu leiden: Vor ein paar Monaten bekam diese anlässlich ihres Kindergeburtstags einen Buchgutschein über 7 € von dem kleinen Buchladen hier im Viertel geschenkt, und wir kamen gar nicht dazu, ihn einzulösen, weil die Besitzerin des Ladens kurze Zeit später dicht machte, abgeworben von eben jenem neuen Thalia. Im Grunde also so, wie "E-Mail für Dich" mit Tom Hanks und Meg Ryan weiterginge, wenn nach dem Happyend nicht Schluss wäre.
Aber das Böse als Faszinosum, ein bekanntes Motiv. Vorletzten Samstag war ich also doch mal schauen: Proppenvoll, Angebot riesig, die einzelnen Themenecken ansprechend gestaltet, in der englischen Abteilung holzgetäfelte Wände und edle Ledersessel, ein eigenes Café, in einer anderen Ecke mixten zwei Bewestete Gratiscocktails. Bei mir kann man, wenn ich in der Stimmung bin, zuverlässig mit prunkvollen Ausstattungen punkten, und so fiel mir nach kurzer Zeit ein grossformatiger, in grünem Leinen gebundener Band auf, der prächtige Zeichnungen von Vögeln und Pflanzen enthielt. Es handelte sich um "Reise um die Welt. Illustriert von eigener Hand" vor 230 Jahren von Georg Forster.
Den musste ich haben. Allerdings sollte er 79 € kosten. Da ich am Jahresanfang gezwungenermassen in die ungünstige Steuerklasse V gewechselt bin, würde ein Spontankauf in dieser schwindelerregenden Höhe mein verfügbares Einkommen in den dreistelligen Bereich abstürzen lassen – keine Option angesichts des Kostenapparates, den ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Es mussten also andere Wege ersonnen werden.
Volker Jahr / Dauerhafter Link / Kommentare (2) / Buch kaufen und selber lesen
23.11.2007 / 07:58 / Bruno Klang liest: Ein unauffälliger Mann (Charles Chadwick)
Abends alleine in der Wohnung sitzen (495-670)

Mitleid, Mitgefühl, Rührung, wenn Sie sich die Beine wegdenken
Quelle (Andreas Trepte, Marburg) Stellen Sie sich einmal den semantischen Raum bildlich vor, der aus den Begriffen Mitleid, Mitgefühl und Rührung gebildet wird. Bei mir sieht dieser Begriffsraum ungefähr aus wie eine beinlose Ente. Das Mitgefühl ist der dicke Körper, der sich beim Mitleid zum Schwänzchen auswächst, und auf der anderen Seite hängt die Rührung dran. Vielleicht können Sie sich das irgendwie vorstellen.
Tom Ripple sitzt also allein und sechzigjährig in seiner Wohnung in Highbury, schiebt sich abends einen Kräuterkuchen in den Backofen, guckt den Mädchen hinterher, unterhält sich mit seinen komischen Nachbarn, guckt abends Fernsehen und schreibt das alles, alles für uns auf. Es ist schon klar, dass irgendwann einmal nicht mehr viel vor uns liegt, nachdem hoffentlich ziemlich viel hinter uns gelegen haben wird. Aber was machen wir eigentlich, wenn letzteres nicht geklappt hat?
Das gilt nicht nur für Tom Ripple, sondern auch für das restliche Personal. Etwa seine Nachbarin, die polnische Witwe Mrs. Bradecki, die er nach Warschau und Treblinka begleitet, weil sie nicht auf sich selbst achtgeben kann, oder weil eine Ablehnung mehr Entschlossenheit erfordert hätte als eine Zusage. Im Standardrepertoire eines Romans wäre das so etwas wie ein "Wendepunkt" etc. etc., aber für uns und Tom Ripple bleibt auch Polen blass, und grau war es sowieso schon.
Oder die beiden Tänzerinnen. Michelle entwickelt sich zum Ballettschwan, Annelise hingegen tanzt schlecht und enttäuscht die Erwartungen ihrer Familie. Tom Ripple versucht, den beiden Mädchen wichtig zu werden, aber auch das funktioniert nicht. Das ist einfach mal so herunterberichtet, und ich kann Ihnen noch nicht einmal sagen, ob das trostlos oder entenfähig ist, und vor allem, an welcher Stelle der Ente.
Zustand: Beim Lesen wird die linke Hand mittlerweile mehr belastet als die rechte.
Prophezeiung: (nach diversen Prognosefehlern mal etwas Einfaches:) Tom Ripple zieht bald um.
Bruno Klang / Dauerhafter Link / Kommentare (1) / Buch kaufen und selber lesen
23.11.2007 / 02:52 / Bettina Andrae liest: Meine wichtigsten Körperfunktionen (Jochen Schmidt)
Schmidt hilft mit (17-21)

Hier verhilft Schmidt Mannheim zu einer attraktiven Stadtansicht, obwohl es keine echten Ostplattenbauten hatSchmidt hatte mich nach seinem Training angerufen, um mir bei der Pflege der erkrankten Tochter zur Hand zu gehen. Er würde so um die Abendbrotszeit herum eintreffen. Seine Opferbereitschaft rührte mich immer wieder. Er hatte extra darauf verzichtet, sie diese Woche zu betreuen, um so die Gefahr zu vermeiden, die darin bestand, dass die Tochter sich nach Genesung in der kommenden Woche wegen verbliebener Bakterien in seiner Wohnung erneut infizieren könnte.
Es war wie Musik in meinen Ohren, als er gelangweilt die Ukulele der Tochter aus der Hand legte. Zuvor hatte er dem Kind ihretwegen eine halbe Stunde lang auf dem Krankenbett das Gesetz des Stärkeren zu erklären versucht und war erfolgreich dabei gewesen. Zumindest vermutete ich das; ich sass im Nebenzimmer und versuchte, mich auf die Beschreibung einer alpinen Landschaft mit See für eine Arbeit zu konzentrieren. Schmidt übte eine halbe Stunde lang Katjuscha oder wenigstens die ersten vier Akkorde des russischen Liedes, bis er hungrig davon wurde und die Tochter schickte, um Erkundungen bezüglich der Abendbrotzeit einzuholen. Ich verstand das nicht; seinen Erzählungen nach war er jahrelang in einer Band Gitarrist gewesen, was einer der Gründe dafür war, weshalb ich mir ein Kind von ihm erschlich. Ich selbst war ja von Kindesbeinen sehr unmusikalisch, hoffte aber wenigstens auf talentierten Nachwuchs, der dieses Bedürfnis in mir ersatzweise stillen könnte.
Die Tochter war nur schlecht zu verstehen, die Krankheit nahm ihr Atem und Stimme, aber mit mütterlichem Einfühlvermögen hörte ich heraus, dass ihr Vater momentan allergisch auf Teigwaren sei, auch Tomaten vertrüge er schlecht gerade. Da an Konzentration nicht zu denken war, nahm ich mir Meine Hilfsbereitschaft, die nächste Körperfunktion Schmidts, mit in die Küche. Das schmidtschste Problem schlechthin: der Undank der Welt, der ihm entgegenschlägt. Aus Kalkül und Eigennutz melden sich vermeintliche Freunde und angebliche Verwandte bei ihm, um ihn mit Wartungsaufgaben zu betrauen, während sie selbst in fernen Ländern in der Sonne faulenzen. Schmidt muss fremde Briefkästen leeren, Haustiere füttern, Pflanzen giessen und Strohwitwen sexuell befriedigen. Die Aufgaben werden zum Vollzeit-Marathon-Job. Schmidt hilft jedem. Wegen der weit voneinander entfernt liegenden Arbeitsorte schläft er nur noch in Parks, er ist ein Erniedrigter und Beleidigter, dem zu guter Letzt die Arme zerschlagen werden, weil er den übernommenen Aufgaben pflichtbewusst nachzukommen sucht. Sein einziger Trost ist das Lesen fremder Urlaubspost.
Mein Coq au vin war in der Tat angebrannt und vor allem: masslos versalzen. Mit dieser Kritik hatte Schmidt so recht, wie man dies nur irgend haben konnte. Es schien mir auch taktlos, dies mit meiner Mitgenommenheit aufgrund der Kochlektüre zu entschuldigen. Ich wollte nicht in alten Wunden bohren. Schliesslich: warum hatte sich Schmidt all dies von der Seele geschrieben? Wie jedem Künstler war mir natürlich bewusst, dass das eigene Werk nur einen einzigen Zweck verfolgt: die Therapie. Noch lange, nachdem Schmidt gegangen war, dachte ich über seine Abschiedsworte nach. "Du hast es gut, du kannst immerhin noch Köchin werden, wenn alles andere nichts wird. Ich kann gar nichts." Wenn es doch nichts mit der Musikalität der Tochter würde, dann doch gewiss in Sachen Lang- und Demut.
Bettina Andrae / Dauerhafter Link / Buch kaufen und selber lesen
